"Wie bringen wir Lehrende dazu, nicht nur über KI zu diskutieren, sondern aktiv damit zu arbeiten?" Diese Frage beschäftigte mich im vergangenen Sommer, als wir die ersten KI-Weiterbildungen für Lehrende an der FH Burgenland planten. Damals ahnte ich noch nicht, welche Dynamik sich daraus entwickeln würde.
Ein Jahr später bin ich an einem Punkt angelangt, den ich mir damals kaum vorstellen konnte. Die FH Burgenland und die Akademie Burgenland als Veranstalterin haben ein beeindruckendes Weiterbildungsprogramm zu KI in der Lehre entwickelt und erfolgreich durchgeführt. Im Juli dieses Jahres haben wir unser Angebot nochmals erweitert. Das neue Zertifikatsprogramm der Akademie Burgenland ist das Ergebnis unserer gemeinsamen Bemühungen - einer Reise, die mit einer einfachen Frage begann und sich zu einem spannenden Abenteuer in der Weiterbildung von Lehrenden entwickelt hat. In diesem Beitrag möchte ich diesen Weg reflektieren und die Erkenntnisse, die ich auf dieser Reise gewonnen habe, teilen.
Das ATHENA KI-Zertifikat
Unser ATHENA KI-Zertifikat besteht aus zwei Teilen: dem Basisprogramm und dem Advanced Programm. Im Basisprogramm geht es um grundlegende Themen wie Einführung in die KI, Veränderung der Prüfungskultur, Erstellung von Lehr- und Lerninhalten mit KI, wissenschaftliches Arbeiten mit KI und Prompting. Besonders stolz bin ich auf unser neues Modul zu Prompting, das den Teilnehmenden eine umfassende Auseinandersetzung mit dieser wichtigen Technologie ermöglicht.
Nachdem das Basisprogramm im letzten Studienjahr so gut angenommen wurde, haben wir uns gefragt, was die nächsten Schritte für diejenigen sein könnten, die bereits einen Einstieg in die KI gefunden haben. Daraus ist unser Advanced-Programm entstanden. Es bietet vertiefende Kurse zu didaktischen Veränderungen durch KI, Prompting für wissenschaftliches Arbeiten, spezielle KI-Tools für wissenschaftliches Arbeiten, Erstellung von personalisierten ChatBots sowie KI und qualitatives Arbeiten, insbesondere mit MAXQDA.
In die Entwicklung des Advanced-Programms flossen auch meine Erfahrungen aus dem Masterstudiengang E-Learning und Wissensmanagement ein. Dort erhalten die Studierenden bereits im ersten Studienjahr eine umfassende Einführung in KI. Ich habe mich gefragt: Welches Wissen über KI braucht man, um E-Learning-Inhalte zu erstellen und eine Masterarbeit zu schreiben?
Struktur und Zugänglichkeit
Alle Kurse finden online statt und umfassen zwei bis drei Termine von jeweils zwei Stunden. Für das KI-Basiszertifikat müssen 3 Kurse aus dem Basisprogramm erfolgreich abgeschlossen werden. Für das KI-Advanced-Zertifikat werden 3 Kurse aus dem Basisprogramm und 3 Advanced-Kurse benötigt.
Das Weiterbildungsprogramm steht den rund 800 haupt- und nebenberuflich Lehrenden der FH Burgenland Unternehmensgruppe kostenlos zur Verfügung. Externe Interessierte können gegen Gebühr teilnehmen. Die gesamte Organisation und Abwicklung erfolgt über die Akademie Burgenland, deren professionelle und effiziente Arbeitsweise ich sehr schätze.
Erkenntnisse und Anpassungen
Die Durchführung der KI-Weiterbildung war ein kontinuierlicher Lernprozess, der viele Erkenntnisse und Anpassungen mit sich brachte. Als erfahrene Trainerin im Bereich E-Learning und Wissensmanagement musste ich meine eigenen Methoden überdenken und an die spezifischen Bedürfnisse unserer heterogenen Teilnehmendengruppe anpassen.
In meinen regulären Lehrveranstaltungen verwende ich gerne komplexe Tools wie Miro für synchrone Online-Settings. Damit kann ich auch anspruchsvolle Inhalte und interaktive Workshops abbilden. Allerdings setzen solche Tools eine gewisse Vertrautheit mit digitalen Werkzeugen voraus, die bei meinen Studierenden durch eine Einführung zu Beginn der Lehrveranstaltung und ihren Erfahrungen mit dem E-Learning-Studium gegeben ist.
Für unsere KI-Schulungen, die sich an ein breiteres und sehr heterogenes Publikum in Bezug auf die technische Affinität richten, mussten wir umdenken. Wir haben uns entschieden, für alle Kurse des KI-Programms auf Padlet umzusteigen. Nicht weil es das "beste" Online-Whiteboard ist, sondern weil es für die Teilnehmenden am einfachsten zu benutzen ist. Diese Entscheidung ermöglicht es uns, uns auf die Inhalte zu konzentrieren, ohne von technischen Hürden abgelenkt zu werden.
Eine weitere wichtige Erkenntnis betrifft die Balance zwischen Input und Austausch. Der Austausch zwischen den Teilnehmenden ist besonders wertvoll in KI-Kursen und wird von den Lehrenden sehr geschätzt. Ich habe jedoch festgestellt, dass in einem zweistündigen Kurs die Inputphase zu kurz kommen kann, wenn der Austausch zu viel Raum einnimmt. Dies ist besonders schwierig, da das Thema KI für viele Lehrende emotional besetzt ist und oft zu lebhaften Diskussionen führt.
Ich plane jetzt einen offenen Austausch erst nach einer strukturierten Inputphase mit klarer Zeitbegrenzung und vorgegebenen Fragen, oft auch in Kleingruppen. So ist gewährleistet, dass sowohl der Wissensinput als auch der wertvolle Erfahrungsaustausch ihren Platz finden. Weitere Anpassungen umfassen realistischere Erwartungen an Aufgaben zwischen den Terminen und die Vermeidung von Kursen am Ende des Semesters, wenn die Arbeitsbelastung der Lehrenden besonders hoch ist.
Trotz der Herausforderungen und notwendigen Anpassungen habe ich sehr positive Rückmeldungen zu meinen Kursen erhalten. Dies bestärkt mich darin, dass wir auf dem richtigen Weg sind und motiviert mich, meine Kurse kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Persönliche Schwerpunkte
Ich sehe meine Aufgabe darin, die Teilnehmenden zu motivieren, KI selbst auszuprobieren. Die Kurse können nur ein Anstoß für eine vertiefte Auseinandersetzung sein. Meine Erfahrung zeigt: Wirklich gut wird man erst, wenn man das Gelernte selbst im eigenen Arbeitsumfeld anwendet. Oft sind Tage oder sogar Nächte des Experimentierens mit KI notwendig, um das volle Potenzial zu erkennen.
Besonders spannend finde ich derzeit die Erstellung von personalisierten ChatBots, die ich selbst intensiv einsetze. In einer neu konzipierten Lehrveranstaltung werden meine Studierenden in diesem Semester selbst solche ChatBots erstellen. Zusätzlich werde ich den Kurs für Lehrende zu diesem Thema halten.
Blick in die Zukunft und Alternativen
Die Entwicklungen rund um KI sind rasant und es ist wichtiger denn je, dass sich Lehrende an Hochschulen damit auseinandersetzen. Mit unserem ATHENA KI Zertifikat haben wir einen Weg gefunden, Lehrende auf diesem Weg zu begleiten und zu unterstützen.
Allen, die sich für diese Themen interessieren, aber nicht an einer Fortbildung teilnehmen können oder wollen, empfehle ich die kostenlosen Online-Kurse des KI Campus. Sie bieten einen guten deutschsprachigen Einstieg, aber auch eine Vertiefung in das Thema.
Unsere Reise mit KI in der Lehre hat gerade erst begonnen. Der Weg führt vom Reden zum Handeln, vom theoretischen Wissen zur praktischen Anwendung. Und auf diesem Weg lernen wir alle ständig dazu.
MEINE LINKEDIN-BEITRÄGE
Die folgenden LinkedIn-Beiträge habe ich seit dem letzten Newsletter veröffentlicht und sind auch ohne LinkedIn-Mitgliedschaft frei zugänglich:
Eine Übersichtstudie über KI für die Lehr-/Lernpraxis
Wie entwickelt sich die KI-Forschung im Bildungsbereich? Eine systematische Literaturanalyse von Ogunleye et al. (2024) liefert spannende Erkenntnisse.
Die Bewertungsskala für Künstliche Intelligenz (AIAS)
Die "Artificial Intelligence Assessment Scale" (AIAS) von Perkins et al. (2024) verspricht, den Einsatz von KI bei der Bewertung von Aufgaben neu zu definieren. Kernstück ist eine fünfstufige Skala für den ethischen Einsatz von KI in Bewertungen.
Podcast über KI und wissenschaftliches Schreiben
Hört rein in mein Gespräch im #LectureCast! Ein herzliches Dankeschön an Andreas Hebbel-Seeger für die inspirierende Unterhaltung! Wir sind tief in die Zukunft des wissenschaftlichen Schreibens mit KI eingetaucht.




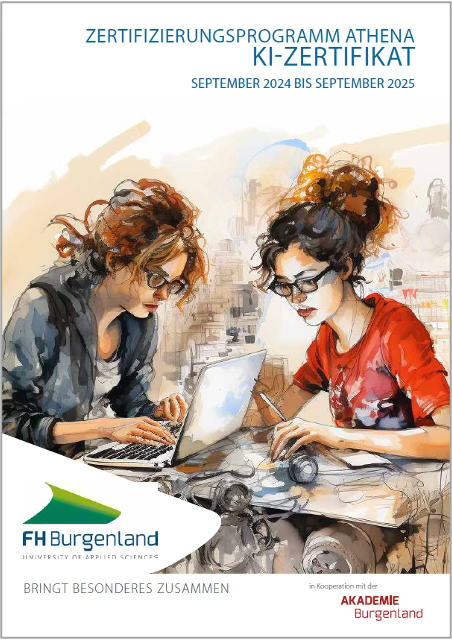

Tolle Sache Barbara!
"Pionierin der Lehre mit KI" ✨👏🏼